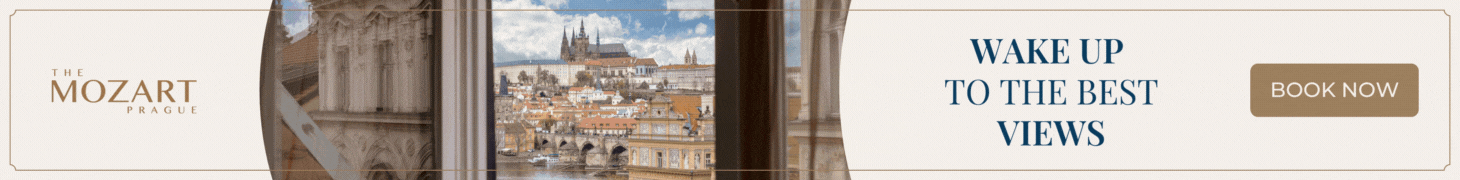Händels Förderer, der 4. Earl of Shaftesbury, verfasste nach der Arminio-Uraufführung eine persönliche Musikkritik, in der er über die Titelrolle schrieb: „[...] Ich hatte doch einen völlig anderen Eindruck von ihm, als ich mir vorher vorgestellt hatte. Glücklicherweise hatte ich mich geirrt und war positiv überrascht, denn er übertraf meine Erwartungen bei weitem.“ Gar „als eine der besten“ urteilte er über die Oper insgesamt, verstellten ihr Misserfolg doch lange den ausgeglichenen Blick auf Händels unvergleichliches Können in diesem lohnenswerten Schwert-und-Sandalen-Revival. Knapp fünfundachtzig Kilometer Luftlinie entfernt vom Ort des Geschehens, dem Teuteburger Wald und der Geschichte um die berüchtigte Varusschlacht, die hier ganz operal einem aufmontierten familiären Beziehungsdrama weichen muss, erlebte Arminio nun nach Produktionen in Halle und Karlsruhe seine Premiere auch bei der dritten Institution von Händelfestspielen, denjenigen in Göttingen.
Konflikte – diesjähriges Festival-Motto – gibt es also in der Handlung zuhauf und diese ebenso in der Inszenierung von Erich Sidler, der vielleicht gewollt in seiner an sich klassisch gehaltenen Regiearbeit ein wenig mehr Verwirrung stiftet als die Handlung selbst. Im Mittelpunkt der kargen Bühne von Dirk Becker (eigentlich gut, um sich auf Charaktere und Musik zu konzentrieren), erst halber Fin-de-Siècle-Saal mit zwei riesigen Kronleuchtern, die mit den Akten verschwinden, bis eine trostlose, nächtliche, angedeutete Burgkulisse übrig bleibt, kreist ein Rechteck als Arminios Kerker. In ihm wird der Cherusker zum Ausstellungsstück und kurzzeitig künstlerischem Beobachtungsobjekt in einer luftigen Vitrine (nachher ein Gehege an reminiszierend-waldigem Weiher). Hermann, eine verklärte und sich selbst verklärende Figur; ein Held, der seine Eigenschaften nicht einsetzt und Worten gar keine Taten folgen lässt?
Arminio durchlebt sein Heroentum mit seiner Frau Tusnelda dabei außerhalb des Gefängnisses, mit geschlossenen Augen, ebenfalls wie die finale Schlacht. Eine Idee zur Mythoskritik, die aber schwerlich mit der Handlung in Einklang zu bringen ist, wenn diese im Jetzt weiterläuft und Arminio daraufhin mit seinen Gegenspielern konfrontiert wird, denen gegenüber er sich bei offenen Augen standhaft gibt, um dem geschriebenen Geschehen schließlich Rechnung zu tragen. Hinzu kommt ein störendes Durcheinander an Kostümen (von Renée Listerdal), sodass von Kleidung postmodernen Chics, Alltagskluft und Uniformen aus der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts allerhand vorhanden ist. Arminio entwickelt sich dabei vom Fast-Traumschiff-Kapitäns-Dress, über frühere Feldherrenausstattung bis zur römischen Montur im Gegensatz zum ruhmreichen Äußeren zurück, während sich seine Widersacher jeweils der Jacken entledigen. Außerdem gibt es moderne Pistolen und statt Sandalen mal wieder Stiefel; zu Beginn noch eine Figurenpräsentation in posierender Mannequin-Challenge. Das alles ist hingegen nicht neu.
Uneingeschränkt stimmig und heroisch waren die musikalischen Leistungen, bei denen lediglich Paul Hopwood als Varo mit seinen zwei zur Verfügung bekommenen Arien blasser blieb. Die Intonationsschwierigkeiten der ersten und anfänglich zweiten machten ganz zum Ende seiner (unter dem einmaligen Einsatz der Hörner aufgeputschten) lässigen Siegesgewissheit endlich dem Durchdringen, der Präsenz und Technik Platz. Damit hatten die anderen Solisten kein Problem, die alle leidenschaftlich, agil und vibrierend timbriert dem Drama stimmliche Nahrung gaben, die in puncto Balance glücklicherweise in keinerlei Konflikt zum Festspiel Orchester Göttingen stand, das Laurence Cummings mit sparsamen Bewegungen zu eingespielten Höchstleistungen brachte. Es würzte die ganzen Rasereien mit starker Dynamik, fülligem Klang und gewetztem Biss von aufwühlenden, harten, blitzenden Streichern und noch griffigerem Continuo, die straff stampfend und bürstig die von Händel geschickt eingebauten Effekte und Stimmungsmarker von der Kette ließen und genauso im Fluss waren mit den kontrastierenden schönen Sinnlichkeitsmelodien.
Ketten legte Arminio sein übergelaufener Schwiegervater Segeste an, den Cody Quattlebaum in seiner urgewaltigen Erscheinung mit fürchtender Kernigkeit und Aggressivität statuierte. Am siegreichen Ende Arminios machte er – gehasst von den eigenen Kindern – den Bückling vor ihm, um feige verschont zu bleiben. Ob es wirklich was half, man weiß es nicht bei Händels uneindeutigem lieto fine in Moll. Brüllte Segestes Bass in angegriffenem Stolz seine Wut in tiefer und ungehobelter Abgründigkeit heraus, präsentierte sich Owen Willetts geschmeidiger und gehorsamst rhythmischer Countertenor als fieslingsberatendes stilles Wasser des noch blutrünstigeren Abgrunds dahinter, ein im Wohlklang gerissener Tullio mit sadistischer Prägung.
Counter-Kollege Christopher Lowrey schmückte manchmal eben nicht ganz ernst zu nehmendes Fremd- und Selbstbild des Arminio mit weicher und reiner Erhabenheit, der sich mit Betonung, Phrasierungsgewandheit und Verständlichkeit sprudelnd bravourös dem Einknicken vor Segeste widersetzte, expressiv entschweben wollte und schließlich kämpferisch beschwingt durch seine klaren und zündelnden Lagen ritt. In trunkener Hoffnung fast überdreht, erwiderte ihm Anna Devin als Tusnelda, die zuvor trotz verzückend zerfließenden Selbstleids ihren Bruder tröstete und dabei immer in ihrem galanten und starken Sopran eine Entschlossenheit durchscheinen ließ, die sie befähigte, munter zu schäumen und sich mutig gegen den Vater zu stellen.
Obwohl auch mit Vibrato bebend und flammend, zeigte sich Sophie Junker als zerrissener Sigismondo noch verständlicher und artikulatorisch so klar und variabel (leicht mit eingezogenen Seelenanrufen), dass ihre identifikatorisch naturgewaltlichen Ausdrücke in allen Registern die glänzenden, emotionalen Meisterstücke des Abends schlechthin bildeten. Die geliebte Remise besetzte Helena Rasker mit ihrem dunklen, farb- und betonungsreichen, wendigen, perlenden Alt in schmissigen Arien. Exquisit eben wie die Oper. Shaftesbury hatte Recht.