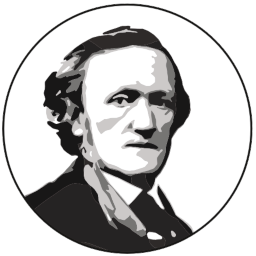Richard Wagners „Tristan und Isolde“ in der Neuinszenierung am Theater Nordhausen: Kritik und Interview mit Dirigent Michael Helmrath.

Als erstes fiel mir Ralph Bollmanns Theaterrundreise „Walküre in Detmold“ ein, als ich von der „Tristan“-Produktion in Nordhausen erfuhr. Wagner in einem Haus, das keine 500 Zuschauer fasst (und zur Premiere nur vierzig Prozent reinlassen durfte)? Mit einem Orchester, das gerade mal 50 Musiker zählt, dazu jede Menge Debütanten auf, vor und hinter der Bühne? Ist das nicht ein aberwitziger Plan? Ist es. Trotzdem hat es funktioniert, und zwar mehr als beachtlich, ja zum Teil begeisternd.
Was gute Gründe hat, denn erstens eignet sich kein wagnerisches Musikdrama mehr zum intimen Kammerspiel als eben „Tristan und Isolde“. Und zweitens steht in Nordhausen Michael Helmrath am Pult, von Herbst 2016 bis Sommer 2021 Generalmusikdirektor des Theaters und des dazugehörigen Loh-Orchesters Sondershausen. Dem Dirigenten war bei der wegen Corona verschobenen Premiere nirgends anzumerken, dass das auch für ihn der erste komplette „Tristan“ war. Vielmehr war zu hören, dass da einer nicht nur die Partitur gut kennt – und, vor allem was die Tempi betrifft, die von Felix Mottl überlieferten Angaben Wagners –, sondern auch seine Instrumentalisten. Der frühere Solo-Oboist der Münchner Philharmoniker und langjährige Chef der Brandenburger Symphoniker weiß seine Musiker für diese außerordentliche Aufgabe zu motivieren und hat keine Angst davor, wenn die Streicherbesetzung noch deutlich unter dem liegt, was als Mindeststandard gilt. Natürlich ist ein derart dünner Streicherklang zuweilen grenzwertig, aber indem Helmrath entsprechende dynamische Retuschen vornimmt, damit insgesamt die Balance wieder stimmt, ist es ein zuweilen kammermusikalischer, aber dennoch ein veritabler Wagnerklang.

Das kommt vor allem den Solisten zugute, bis auf zwei Ausnahmen Rollendebütanten. Der Star des Abends ist Kirstin Sharpin als Isolde. Die aus Neuseeland stammende Sopranistin und Gewinnerin des Wagnerstimmenwettbewerbs 2015 in Karlsruhe rechtfertigt diesen Preis mir einer wunderbar klaren, sicheren, wortverständlichen und geschmeidigen, an den richtigen Stellen auch strahlkräftigen Stimme. Sie weiß und versteht, was sie singt, auch in ihrer Mimik und Körpersprache wirkt alles natürlich. Schade, dass Alexander Schulz als Tristan nicht über diese sängerdarstellerische Präsenz verfügt. Zwar lässt er vor allem im 3. Akt heldentenoral aufhorchen, doch vermag er sein stimmliches Potenzial nicht durchgängig und ausgeglichen einzusetzen. Als bestes Ensemblemitglied reüssiert Thomas Kohl als nur in den höchsten Tönen nicht souveräner König Marke, auch die weiteren Partien sind spielfreudig und gut besetzt. Dazu der von Markus Fischer einstudierte Herren- und Extrachor des Hauses sowie einige Statisten.

Ivan Alboresi, Ballettdirektor des Hauses, hat erstmals eine Oper inszeniert – noch ein gelungenes Debüt! In einer drastisch reduzierten Ästhetik mit einigen regietheatermodischen Einsprengseln versucht er, „die pure Essenz der Emotionen“ der Titelprotagonisten und der sie umkreisenden Figuren freizulegen. Die abstrakte Bühne von Wolfgang Kurima Rauschning besteht aus einem mehrfach gestaffelten, wandelbaren Plafond und einer drehbaren großen Schräge, die in allen drei Akten mit je unterschiedlichem Material belegt ist und von der im letzten Akt nur noch Bruchstücke vorhanden sind. Einige stimmige Projektionen und farbiges Licht genügen, um dem Publikum den Freiraum für passende Assoziationen zu geben. Die heutigen Kostüme von Dietrich von Grebmer setzen in der immer wieder surreal wirkenden und hin und wieder von Choristen und Statisten belebten Szenerie auch farbige Akzente. Wer wie von ungefähr ein bisschen an Neubayreuth denkt, liegt nicht falsch. Die Figuren bewegen sich teilweise wie Skulpturen im Raum, sind aber gleichzeitig sehr menschlich in ihrem Gefühlschaos. Auch wenn viel an der Rampe gesungen wird, ist das nur mit einer Ausnahme Rampensingen. Vielmehr intensiviert die gegebene Nähe den Ausdruck der Sängerinnen und Sänger, transportiert das, was die handelnden Personen in ihrem Innersten bewegt.

Ein Sonderlob gebührt den zuschauerfreundlich großen Übertiteln, unbedingt zu tadeln bleibt die unorthodoxe Vorhangregie, die der Titelprotagonistin und dem Publikum den ersten befreienden Applaus nicht gönnt und stattdessen zunächst die Statisten auf die Bühne schickt. Schade, dass keiner dem Operndebütanten Alboresi davon abgeraten hat. Denn damit wird den Hauptsolisten und dem gleichermaßen aufgewühlten Publikum im Saal verweigert, genau das zu empfangen beziehungsweise auszudrücken, worum es doch dreieinhalb Stunden lang gegangen ist: jede Menge Emotionen.

Besuchte Premiere am 29. Januar 2022, weitere Vorstellungen am 13. und 19. Februar, 26. März und 7. Mai. Weiter Infos https://theater-nordhausen.de/
Nach der Premiere der „Tristan“-Neuinszenierung in Nordhausen, wo dieses Wagnerwerk vor 100 Jahren erstmals aufgeführt wurde, konnte ich einige Fragen an Dirigenten Matthias Helmrath stellen.
Haben Sie eine Bearbeitung der Partitur benutzt? Reduzierte Versionen sind ja nicht erst seit Corona im Umlauf …
Michael Helmrath: Notgedrungen habe ich mir diverse Bearbeitungen angeschaut, sie jedoch wieder verworfen. Wir verwenden das verbreitete Breitkopf-Material; natürlich muss man des Öfteren teilweise erhebliche, zumeist dynamische Retuschen vornehmen, da Wagner überaus großzügig mit forte und fortissimo umgeht. Er selbst hat diese nach seinen praktischen Erfahrungen auch vorgenommen; die meisten ergeben sich in der Probenarbeit. Die Balance lässt sich nicht mittels dürrer dynamischer Anweisungen herstellen – was genau ist ein mezzoforte? –, sondern setzt ein mit-denkendes und -hörendes Orchester voraus, das flexibel reagiert. Daraus besteht ohnehin stets der Großteil der musikalischen Arbeit, nicht nur in der Oper, nicht nur bei Wagner.
Welche Abstriche gab es in den Instrumentengruppen?
Michael Helmrath: Bei den Bläsern keine, denn, wie erwähnt, litten dabei die wunderbar ausgehörten Feinheiten der Instrumentation Wagners. Der Orchestergraben im Theater Nordhausen ist sehr klein, wie Sie ja vermutlich mit Schrecken festgestellt haben. Das Loh-Orchester ist, vor allem in den Streichern, auch nicht üppig besetzt. Dennoch teile ich die Einstellung des Intendanten, das Repertoire nicht immer auf die Grabengröße abzustimmen; das Problem besteht bekanntlich nicht nur in Nordhausen.
Daher „leistet“ sich das Theater immer wieder Werke, in denen die Besetzung an ihre Grenzen kommt. Unter anderem haben wir „Salome“, „Otello“, „Les Dialogues des Carmélites“ oder „Madama Butterfly“ aufgeführt und nur bei „Salome“ eine von Strauss selbst leicht reduzierte Version verwendet (wobei Pauke und fünf Schlagzeuger hinter die Bühne verbannt werden mussten, was zur allseitigen Überraschung dank vorzüglicher Tontechnik sehr gut funktionierte). Wenn also bei den Bläsern nicht reduziert wird, so bleibt nur eine nicht wirklich adäquate, sprich: kleine Streicherbesetzung, da man die Musiker nicht stapeln kann. Genau sind es 7/6/5/4/2 [1. Geige/2. Geige/Bratsche/Cello/Kontabass], wünschenswert wären mindestens 12/10/8/6/4, was für uns illusorisch ist. Damit muss ein so kleines Haus einfach leben. Es entspricht im Übrigen meiner Meinung nach den Aufgaben eines Stadttheaters, dem Publikum ein möglichst breites Angebot zu machen, dazu gehören auch die oben erwähnten groß besetzten Werke. Für die „Fortgeschrittenen“ oder „Angefixten“ gibt es Zugverbindungen in die Metropolen oder nach Bayreuth…
Wo genau haben Sie gestrichen?
Michael Helmrath: Ich habe mich für einen Strich im zweiten Akt entschieden, der früher ganz üblich war und in etlichen Produktionen nachhörbar ist, unter anderem mit Leinsdorf, Reiner, Karajan in Salzburg und Mailand, Erich Kleiber in Buenos Aires. Wagner hatte bereits erkannt, dass der zweite Akt, insbesondere für den Sänger des Tristan, so belastend ist, dass der ganz besonders strapaziöse dritte Akt dann nur mit Mühen zu bewältigen ist. Er hat auch einen etwas anderen Strich vorgeschlagen, war aber doch Praktiker genug, um die Sänger nicht in der Mitte der Oper frühzeitig stimmlich sterben zu lassen. Er hat auch einen Strich im 3. Akt vorgegeben, den wir jedoch nicht umgesetzt haben.
Die Aktlängen bei Ihnen?
Michael Helmrath: Nicht sekundengenau 1. Akt: 1 Stunde 15 Minuten; 2. Akt: 1 Stunde 7 Minuten (hier gab es den erwähnten Strich); 3. Akt: 1 Stunde 15 Minuten.
Inwiefern profitiert das Orchester von dem Projekt?
Michael Helmrath: Für ein Orchester wie das Loh-Orchester Sondershausen ist der „Tristan“ eine Herausforderung jenseits der üblichen Routine. Da ist zum einen die schiere Masse an Material, etliche sehr schwer zu spielende Passagen, viele Wechsel und rubati, es bedarf einer großen Flexibilität in Dynamik und Tempo. Die Musiker und Musikerinnen sind allesamt überaus motiviert, sich dieser Aufgabe zu stellen, auch der damit notwendigerweise verbundenen intensiven und langen, anstrengenden Probenarbeit. „Nebenher“ spielen sie das andere Repertoire, zum Beispiel „Der Vetter aus Dingsda“, „L’elisir d’amore“ und unter anderem mit mir die üblichen Neujahrskonzerte in der Endprobenphase des „Tristan“, wo die Fallhöhe zwischen „O, sink hernieder, Nacht der Liebe“ und „Badner Madln“ allzu deutlich erlebbar war. Das Orchester (und das ganze Theater) wird sich an dieses Projekt noch lange erinnern.
War die Produktion Ihr Wunsch?
Michael Helmrath: Der Vorschlag kam vom Intendanten Daniel Klajner. Nachdem ich mich von dem ersten Schock erholt hatte, habe ich mich darauf eingelassen, wobei ich feststellen konnte, dass diese Oper mehr als alle anderen, die ich kenne, denjenigen „auffrisst“, der sich darauf einlässt. Einen „Brocken“ wie den „Tristan“ hatte ich noch nicht zu heben.

Ähnliche Beiträge
- „Traut allein, ewig heim“ 4. März 2022
- „Tristan“ noch dreimal im Theaterzelt 3. April 2017
- Tagesreise zum „Tristan“ im Landshuter Theaterzelt 2. März 2016
- Im schwarzen Nichts 9. Oktober 2019
- Isolde im Nirwana 22. Januar 2020