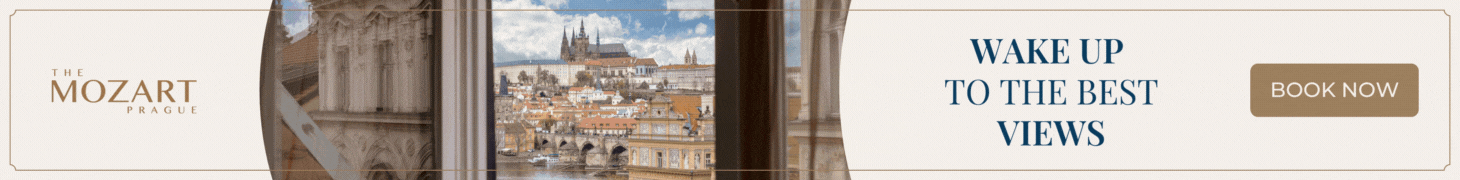Ein junges Mädchen, das in ihrem Begehren nach gesellschaftlichem Aufstieg und Ruhm ihre Schönheit und ihren Körper gnadenlos einsetzt, um ihre Umgebung geschickt zu ihrem Vorteil zu manipulieren: So aktuell dieses Thema klingen mag, so klug umschifft Regisseur Floris Visser die Möglichkeit, Jules Massenets Oper Manon in Zeiten von Instagram und co. anzusiedeln, sondern legt sie in die Entstehungszeit der Oper. Dadurch spießt sich die Inszenierung nie mit dem Libretto und führt dem Publikum dennoch die Zeitlosigkeit des Stoffes vor Augen.
Manon ist an der Oper Zürich gewissermaßen die frühe Form eines It-Girls und um ihre persönliche Entwicklung nachvollziehbar zu machen, bebildert der Regisseur bereits die Ouvertüre. Die kleine Manon findet einen eleganten Handschuh und betrachtet sich damit im Spiegel – der Wunsch, einmal Teil dieser vornehmen Gesellschaft zu werden, scheint so geboren. Der Spiegel als Symbol zieht sich durch die gesamte Inszenierung, bekommt im vierten Akt Risse und sorgt bei Manons Tod für starke Bilder, wenn Splitter des Spiegels als Sternenhimmel fungieren. Überhaupt ist es eine Inszenierung des optischen Genusses. Der beige Kubus, der als Einheitsraum dient und sich dank stimmungsvoller Lichtregie und einiger Requisiten in jedem Akt in den im Libretto beschriebenen Raum verwandelt, lässt sich nach hinten hin öffnen; und so sorgt etwa die dort am Altar auftauchende Manon während Des Grieux in Saint Sulpice davon singt, sie vergessen zu wollen, für großen Effekt. Die Personenregie ist detailliert und erweckt die Figuren so realistisch zum Leben, dass man den beiden in ihrer On-Off-Beziehung eigentlich ganz gerne schlaue Ratschläge aus dem Zuschauerraum zurufen möchte.
Aber nicht nur optisch war der Abend ein Vergnügen, dank einer hochkarätigen Sängerriege wurden auch die Ohren glücklich gemacht. Elsa Dreisig gab eine enorm charmante Manon, die den jugendlich-euphorischen Überschwang ebenso glaubhaft verkörperte wie die pure Lebensgier und schließlich die Reue im Angesicht des Todes. Und auch stimmlich zeigte ihr Sopran all diese Facetten, schimmerte in jeweils der passenden Farbe. Beeindruckend war auch, wie durchdacht und detailreich das Rollenportrait bereits ist, das Dreisig von dieser hin- und hergerissenen Figur zeichnete – und das nur knappe zehn Tage nach ihrem Debüt als Manon. Die Stimme ist delikat und ausgezeichnet geführt, lediglich den tiefen Lagen und der Atemkontrolle bei schnellen Koloraturpassagen fehlt es noch am letzten Feinschliff.
Wunderbar harmonierte Dreisigs Stimme mit der ihres Bühnenpartners Piotr Beczała; im Duett in Saint-Sulpice im dritten Akt sprühten die vokalen Funken wie Raketen in der Silvesternacht. Beczała ist ohnehin ein Phänomen: Egal ob im französischen, slawischen oder italienischen Repertoire, in Operettenschmachtfetzen oder auch als heldischer Lohengrin – dank seiner ausgezeichneten Technik und dem klugen Einsatz seiner stimmlichen Mittel hat man immer das Gefühl, dass er ausschließlich mit den Zinsen seines Materials singt, nie das Kapital angreifen muss. Müsste man eine Schwachstelle suchen, wären es wohl die Piani in exponierten Höhenlagen, die ihn phasenweise an seine Grenzen bringen, aber das wäre wahrlich Meckern auf hohem Niveau. Sein Tenor hat in den vergangenen Monaten nochmals an Substanz und Volumen gewonnen, sich den nostalgischen Schmelz dabei bewahrt und ist einfach – man kann es nicht anders sagen – wirklich ein Hochgenuss.
Und auch rund um das zentrale Paar fanden sich (fast) nur erstklassige Stimmen ein. So sang Yuriy Yurchuk einen profund strömenden Lescaut, der stimmlich und darstellerisch starke Präsenz zeigte; Éric Huchet und Marc Scoffoni machten aus ihren Rollen – Guillot de Morfontaine und De Brétigny – kuriose Charakterstudien von eitlen Männern in der Midlife-Krise. Dem Comte des Grieux von Alastair Miles hätten mehr Präsenz und ein weniger prominentes Vibrato hingegen ganz gut gestanden.
Die drei Grazien Pousette, Javotte und Rosette wurden von Yuliia Zasimova, Natalia Tanasii und Deniz Uzun kokett und schönstimmig auf die Bühne gebracht und der Chor bestach nicht nur mit Klangschönheit, sondern auch durch Spielfreude. À propos Freude: Die bringt Dirigent Marco Armiliato ohnehin immer mit, wenn er ans Pult tritt, was sich auch merklich auf die Philharmonia Zürich übertrug. Die vielfältigen Klangschichten und Emotionsebenen von Massenets Komposition gossen die Musiker in Klang und liebten beziehungsweise litten mit den Sängern gleichermaßen lyrisch zart oder dramatisch aufbrausend mit und verliehen den Gefühlszuständen deutlich Ausdruck.
Man muss nicht zwanghaft jeden Stoff ins Hier und Heute verlegen und eine Inszenierung mit hübschen Kostümen ist nicht automatisch verstaubt, wenn die Personenregie ausgeklügelt ist – das beweist diese Manon an der Oper Zürich eindrucksvoll. Dass es in der Kunstform Oper außerdem nie ein Fehler ist, ein musikalisches Dreamteam auf der Bühne und im Graben zur Verfügung zu haben, so wie es in dieser Vorstellungsserie der Fall ist, ist ohnehin klar.